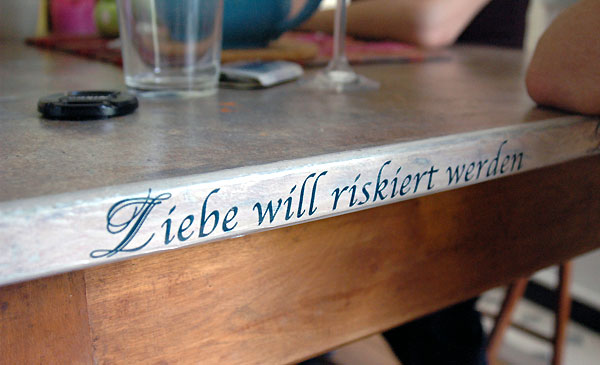Nun sitze ich hier, zusammengekauert auf der Rückbank einer Cessna 172 Skyhawk. Ich ärgere mich, denn ich habe mich zu etwas hinreißen lassen, das ich eigentlich gar nicht will. Menschen gehören auf den Boden, nicht in die Luft. Sonst wären sie Vögel geworden. Ich seufze und schnalle mich an. Noch die Sonnenbrille aufsetzen, damit meine Flugangst nicht so auffällt. So, jetzt sehe ich richtig lässig aus. Dumm nur, dass die Sonne gar nicht scheint.
Nervös bewegt sich mein Knie auf und ab. Ein Blick aus dem leicht verschmutzten Fenster. Dunkle Wolken ziehen aus der Ferne heran, sie wirken bedrohlich. Der Liebste und sein Fliegerfreund vorne im Cockpit entscheiden, nur eine Platzrunde zu drehen. Eine größere Tour wäre jetzt zu riskant; später eventuell, wenn das Wetter besser ist. Die Kerle sind sichtlich enttäuscht darüber, dass sie mir vielleicht nicht mehr als das hier bieten können. Ich tue so, als wäre ich auch betrübt und nicke mitfühlend vor mich hin. In Wahrheit bemitleide ich mich aber gerade selbst und verfluche mich in Gedanken, vorher kein Testament verfasst zu haben.
Die Cessna hüpft zur Piste. Tapfer mache ich gute Mine zum vermeintlich bösen Spiel. Pilot und Copilot unterhalten sich über das Prozedere und machen – wahrscheinlich um mich aufzumuntern – kleine Späße zum Thema Fliegen. Die finde ich aber gar nicht lustig. Ich zwinge mich zu einem gequälten Lächeln und trage es mit Fassung. Lässig. Immerhin trage ich meine Sonnenbrille. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Aber der muss ja auch nicht fliegen.
Ich bin ganz hibbelig und überlege, wieder auszusteigen. Zu spät: Der Pilot drückt den Gashebel. 20 Knoten, 40… 60… Mein Liebster tätschelt mir vom Copilotensitz aus das Knie und fragt, ob alles in Ordnung sei. Mit einem inzwischen auf den Lippen festgeforeren Lächeln schiebe die Sonnenbrille noch weiter ins Gesicht. Bestimmt habe ich jetzt Abdrücke um die Augen. Bei etwa 70 Knoten hebt die kleine Maschine etwas wackelig ab. Der Wind sticht ihr in die Seite.
Schon sind wir oben. Das ging schnell. Es ruckelt ziemlich, und ich fühle mich unbehaglich, aber nicht so sehr wie damals in der Eifel beim Segelfliegen oder den Linienflügen, die ich bisher alle überlebt habe. Die Wolkenfront nähert sich, nach dem Downwind gehen wir schon in den Right Base, den rechten Queranflug. Eine Kurve. Hua! Meine Hände krallen sich in die Oberschenkel. Final. Alles geht ganz schnell. Wir landen, und prompt beginnt es zu regnen. Der Wind ist auch heftiger geworden. Perfektes Landing.
Am Boden beschließen wir, noch etwas zu warten. Vielleicht klärt es sich auf. Dann könnte man doch noch eine Tour machen. Insgeheim wünsche ich mir, dass es so bleibt, wie es ist. Natürlich klärt es sich auf. Durch die Wolken bricht die Sonne, und als es komplett aufhört zu regnen und der Wind nachlässt, dreht mein Liebster noch ein paar Platzrunden, bevor wir uns zu viert erneut in die Cessna setzen. Er gesellt sich zu mir auf die Rückbank; auf dem Copilotenplatz sitzt jetzt der ehemalige Fluglehrer der beiden Fliegerfreunde.
Es geht in Richtung Brocken. Ich staune, denn der Flug ist angenehm ruhig. Ich genieße die Aussicht. Geometrische Formen in der Gestalt von Feldern, Wäldern, kleineren und größeren Orten. Uns zur Rechten macht sich ein großer Regenbogen breit. Inzwischen bin ich kühn geworden: Ich wage einen Griff in meinen Fotorucksack und ziehe sogar die Kamera heraus, mit der ich das farbige Naturwunder einfange.
Nach einem knapp einstündigen Flug trinken wir am Flugplatz Stendal einen Kaffee, vertreten uns kurz die Beine und treten dann den Rückflug an. Mein Liebster, jetzt in der Rolle des Piloten, fragt die anderen Männer, ob sie etwas dagegen hätten, wenn seine Süße zu ihm nach vorne käme. Haben sie nicht. Ohne zu murren quetschen sie sich auf die Rücksitze. Als der Pilot die Maschine sicher in die Luft bringt, bewundere ich ihn heimlich.
Ich lasse die Muskeln locker, schaue mir die Landschaft zur Rechten und den Flieger mir zur Linken an. Er bombardiert mich konsequent mit Fachbegriffen. Ich bin jetzt beinahe entspannt und grinse übermütig vor mich hin. Doch dann deutet der Liebste auf das Steuer. Verdammt, ich hätte es wissen müssen – von Anfang an. „Schätzchen, hältst Du mal kurz? Ich muss eben was suchen.“ Ein entsetzter Blick nach links. Das meint er doch jetzt nicht ernst. Nee oder? Doch. Zumindest schaut er ernst und nimmt die Hände vom Steuer. Mechanisch ergreife ich es und halte es fest in beiden Händen.
„Geil oder? Das fühlt sich doch krass an oder? Da muss man mal ein Gefühl für kriegen!“ Ach ja, muss man das? Und wer fragt mich, ob ICH das will? In diesem Moment sehe ich den Süßen an einem Marterpfahl vor mir. Ich führe Kriegstänze und -gesänge auf, mit bunten Federn im Haar und bedrohlich-bemaltem Gesicht. Doch der Pilot, dessen Aufgabe eigentlich das Fliegen ist, kramt mal hier herum, schaut mal dort nach hinten und dann wieder nach vorn. Doch es kommt schlimmer. „Süße, da vorne links siehst Du ein Dorf. Nimmst Du mal Kurs darauf?“ Der hat sie doch nicht mehr alle! Ich reiße die Augen weit auf und sehe mich nicken.
Ich klammere mich an einen Strohhalm: Das Flugzeug hat eine leichte Neigung nach oben, weswegen ich das Dorf nur schlecht sehen kann. Das bedeute ich dem Liebsten, in der Hoffnung, damit aus dem Schneider zu sein und ihm die Kontrolle wieder übergeben zu können. „Ach so! Stimmt ja.“, sagt er enthusiastisch. „Das macht aber gar nichts, Schätzchen! Da drückst Du das Ruder hier einfach ein bisschen rein. So…“ Er nimmt meine Hände und presst sie mitsamt dem Steuer ein Stück nach innen. Ich gucke ihn hasserfüllt an. Das Flugzeug kippt die Nase nach unten. Das wiederum zwingt mich, wieder nach vorn zu schauen. „Da, nun siehst Du es.“ Er grinst mich stolz an. Das wird er bereuen. Und wie! „Gut machst Du das!“, wagt er doch tatsächlich noch zu sagen. „Guck mal, da unten hast Du zwei Pedale. Tritt doch da mal drauf, damit Du siehst, was dann passiert.“ Wäre ich jetzt verheiratet, würde ich mich SOFORT scheiden lassen. Was soll da schon passieren? Bestimmt nichts Gutes! Ich drücke doch da nicht drauf! Ich bin doch nicht irre!
Ich BIN irre. Denn da ist diese unwiderstehliche Faszination. Anscheinend bin ich verrückt geworden, denn abwechselnd trete ich auf das linke, dann auf das rechte Pedal. Ich ärgere mich über meine Inkonsequenz in Sachen Flugangst. Erst fürchte ich es, dann führe ich es – das Flugzeug. Mit noch immer schweißkalten Händen bediene ich mal das Höhen-, dann das Quer- und später wieder das Seitenruder. Der Liebste lobt mich für mein „Gespür fürs Fliegen“, doch ich würde es jetzt spontan als „Überlebenswillen“ bezeichnen.
Mit wackligen Knien, aber trunken vor Glück, steige ich nach der Landung aus der Maschine. Die Sonne lacht noch immer. Doch mit meinem Strahlen mache ich ihr Konkurrenz. Ich möchte fliegen lernen.