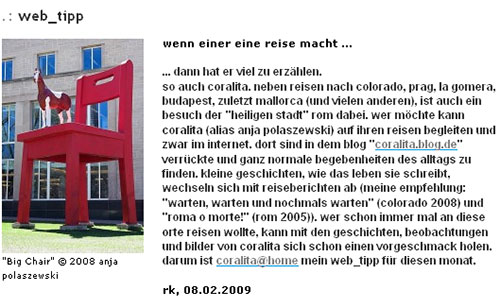Spielplätze sind Orte der Begegnung. Kleine und große Kinder tummeln sich in Sandkästen und auf Klettergerüsten. Sie lernen hier im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch soziales Verhalten und knüpfen erste Freundschaften. Wichtige Lebenerfahrungen werden gemacht. Der Kollwitzplatz im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg ist so ein Ort.

Ein kleines blondes Mädchen um die zweieinhalb Jahre mit geröteten Pausbäckchen ist äußerst ungeduldig: Zu gerne möchte sie schaukeln. Sie hat sich doch so sehr darauf gefreut. Bereits während des Mittagessens hatte sie munter vom Spielplatz geplappert. Doch ein anderes Mädchen ist schon länger da und wartet ebenfalls darauf, dass das Objekt ihrer Begierde frei wird.
Die Kleine mit den Pausbäckchen nähert sich der Schaukel, doch das andere Mädchen ist wagemutiger und traut sich noch dichter an das Gerüst heran. Sie ist etwa ein Jahr älter. Ein paar abschätzige Blicke, und im gegenseitigen stillen Einvernehmen sind die Fronten innerhalb weniger Sekunden geklärt: Die Ältere setzt sich auf die Schaukel, resignierte Blicke von der Jüngeren in Richtung Mama. Die Mundwinkel rutschen nach unten.
Auf einer Bank sitzt ein älterer Herr mit sympathischen Lachfältchen und rot-grau kariertem Baret. Er blättert in einer Zeitung, bis er einen Artikel findet, der ihm offensichtlich zusagt. Ein paar Minuten liest er aufmerksam, dann hebt er den Kopf und schaut dem munteren Treiben der Eltern und Kinder zu. Er scheint zu sinnieren, nachzudenken über den Artikel. Vielleicht erinnert er sich aber auch daran, wie es war, als seine Kinder noch klein waren. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht.
Auf der anderen Seite des Spielplatzes gibt es noch ein weiteres Gerüst mit zwei Schaukeln. Das kleine blonde Mädchen mit den Pausbacken und ihr Papa sehen, dass eine davon frei geworden ist und eilen hin. Der Vater schubst an, die Tochter jauchzt. In der Schaukel daneben sitzt ebenfalls ein Mädchen. Sie ist im gleichen Alter und hat dunkles Haar. Ihr roter Mantel flattert im Wind, während Papi die Schaukel lustlos in Schwung bringt. Auch der andere Vater verliert nach einer Weile die Geduld, schaut dann und wann auf die Uhr und signalisiert der Tochter, dass sie gleich aufbrechen werden. Bei dem anderen Papa das gleiche Prozerede: „Jetzt müssen wir aber los.“ Die Gesichtchen der beiden Kleinen verlieren abrupt ihr Strahlen.
„Ich will aber noch nicht nach Hause!“, sagt die Kleine mit den Pausbacken echauffiert. „Ja, und ich auch nicht!“, erwidert die andere. Die Kleinen schauen sich an, mustern sich interessiert und lassen sich noch eine Weile anschubsen. Die Väter werfen sich belustigte Blicke zu. „Na gut, aber wirklich nicht mehr lange!“, sagt der Papa der Kleinen mit dem roten Mantel.
Gemeinsam und im Takt schubsen die beiden Männer ihre Kinder an. Gleichzeitig gehen die Schaukeln nach vorn, dann wieder nach hinten. Im Moment des Anschubsens geben beide Mädchen Kicherlaute von sich. Auch den Väter sieht man jetzt Freude über das Synchronschaukeln an. Kommunikation und Interaktion – und zwei Kinder als Verbündete.