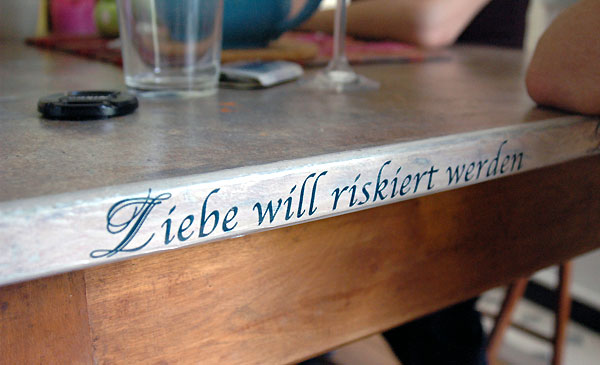Als Kind habe ich an heißen Sommerabenden träumend in einem der zahlreichen Bäume auf unserem Grundstück gehockt und mir ein Leben in freier Wildbahn oder im Dschungel ers(p)onnen. Ich brauchte dazu nur mich selbst. Einen Apfel in der einen, ein Buch in der anderen Hand, glitt ich in Gedanken an robusten Lianen herab, fuhr in einem Kanu auf einem reißenden Fluss oder spielte mit wilden Tieren.
Was für mich eine fantasiereiche Vorstellung war, die ich nur aus Erzählungen kannte, ist für manche Kinder Alltag, zum Beispiel für Sabine Kuegler. Wer gern und oft liest und die Bestsellerlisten verfolgt, kennt ihre Geschichte: Die heute 36-Jährige, die in Nepal geboren wurde, lebte von klein auf mit ihren Eltern (beide Missionare und Sprachforscher) und Geschwistern in West-Papua/Indonesien bei den Fayu, einem damals gerade erst entdeckten Kannibalenvolk, um unter anderem Entwicklungshilfe zu leisten und Frieden zwischen die vier verschiedenen Stämme zu bringen.
In ihrer Autobiographie Dschungelkind beschreibt Sabine Kuegler detailgetreu die Erlebnisse und Erfahrungen aus Kindersicht und ohne politische Stellungnahme, die hier auch absolut fehl am Platz wäre: Sie ist wieder ein kleines Mädchen und spielt mit den Fayu-Kindern, isst Würmer, badet im Fluss mit Krokodilen und sammelt jedes Tierchen, das ihr über den Weg krabbelt. Das kleine Mädchen mit dem strohblonden Haar wächst in unberührter Natur auf und lernt von den Einheimischen, wie man Waffen baut und jagt. Das Wort Angst kennt Sabine nicht. Sie lebt in einem Paradies und genießt ihr Glück fernab jeglicher Zivilisation.
Als sie 17 Jahre alt ist, muss Sabine Kuegler dem Dschungel den Rücken kehren und geht auf ein Internat in der Schweiz. Auslöser für das Verlassen ihrer Heimat ist der Tod eines geliebten Fayu-Freundes. Er war wie ein Bruder für sie, und sie fühlt, dass sie den Bruch mit ihrem derzeitigen Leben wagen muss. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt.
Sabine „zwangszivilisiert“ sich selbst in Europa und erlebt einen Kulturschock. Alles erscheint ihr fremd; sie selbst erscheint als Fremde. Oft schaut man sie an als wäre sie von einem anderen Stern; weil sie andere Gewohnheiten, andere Vorstellungen vom Leben hat. Zu sehr hat sie der Dschungel geprägt, zu tief sitzt die Sehnsucht, wieder dorthin zurückzukehren. Doch sie weiß, dass dies inzwischen kaum mehr möglich ist…
Ich kenne nicht viele Menschen, die ein so lebendiges Strahlen in den Augen haben wie Sabine Kuegler. Bei „Beckmann“ sprach sie 2005 über ihr Leben im Dschungel. Das Leben in der Wildnis sei physisch zwar anstrengender, doch wäre sie dort nie unglücklich gewesen. Die hiesige Zivilisation empfindet Kuegler als psychisch belastender, wenn auch körperlich leichter. Heute lebt sie mit ihren mittlerweile vier Kindern im Norden Deutschlands und schlägt sich tapfer durchs Leben. Doch angekommen ist sie hier nicht.
Bei allem, was Sabine beschreibt, sehe ich sie als kleines Mädchen direkt vor meinen Augen. Ich kann tief eintauchen in das, was sie erlebt und gesehen hat; weil sie es bildhaft darstellt – mit vollem Körpereinsatz und mit viel Herz. Bei jeder Frage, die Beckmann ihr stellt, leuchten ihre hellen Augen auf wie zwei kraftvolle Blitze. Sie lächelt kurz, dann antwortet sie. Und es spielt keine Rolle, ob in ihr schicksalhafte, traurige Erinnerungen wachgerufen werden. Als warmherziger, freundlicher Mensch lächelt sie selbst dann, wenn ein verbaler Schwertstich ihr Herz durchbohrt.
Oft wird Sabine Kuegler gefragt, wie sie es geschafft habe, im Dschungel zu überleben. Für einen kurzen Augenblick verschwindet dann ihr wunderschönes Lächeln, und sie sagt bestimmt, dass für sie der Umkehrschluss zählt: Sie wundert sich, dass sie das moderne Leben hier meistert.
Ich spüre, während ich das Video im Internet sehe, mit jeder Faser das Leid und die Sehnsucht, die sie empfindet und wünsche ihr von Herzen, dass es ihr gelingt, zurück zu sich selbst zu finden – wo auch immer sie sein mag. Denn, wie sagt sie selbst so schön: „Heimat ist ein Gefühl“.
Recht hat sie.